Wenn du dein Vermögen heute betrachtest und nächstes Jahr wieder, dann kennst du vermutlich nur zwei Zahlen: was rein ist, was raus ist. Das ist nicht Rendite – das ist Buchführung. Rendite ist das Versprechen, dass dein Geld arbeitet. Nur: Wer nicht weiß, wie man es misst, weiß auch nicht, ob das Versprechen wahr ist.
Die meisten Anleger rechnen falsch. Sie addieren, subtrahieren, und am Ende glauben sie, 10 Prozent gemacht zu haben – während in Wahrheit 6 Prozent Real-Rendite übrig sind, nach Gebühren, Steuern und Inflation. Die Rendite-Rechnung ist nicht kompliziert. Aber sie ist präzise. Und diese Präzision ist der Unterschied zwischen Vermögen und Geldverschwendung.
Die Rendite: Mehr als eine Zahl
Bevor du rechnest, musst du verstehen, was du überhaupt misst. Rendite ist nicht einfach der Gewinn. Rendite ist der Gewinn im Verhältnis zu dem, was du investiert hast – und dazu kommt noch die Zeit. Ein Gewinn von 1.000 Euro in einem Jahr ist nicht dasselbe wie 1.000 Euro in zehn Jahren. Das ist der Kern: Rendite verbindet Gewinn, Kapital und Zeit zu einer einzigen Kennzahl.
Es gibt verschiedene Arten von Rendite, je nachdem, was du gemessen werden soll. Die einfache Rendite (auch absolute Rendite genannt) ist für schnelle Überschlagsrechnungen nützlich. Aber für reale Entscheidungen brauchst du mehr Differenzierung. Die ROI-Berechnung für KI-Telefonassistenten zeigt ein Business-Beispiel, aber dasselbe Prinzip gilt für jeden Kapitalanleger: Es geht darum, ob deine Investition sich lohnt – gemessen an ihrem Einsatz und ihrem Zeitrahmen.
Die einfache Rendite-Formel
Die elementarste Formel sieht so aus:
Rendite (%) = (Gewinn / eingesetztes Kapital) × 100
Ein Beispiel: Du investierst 10.000 Euro, nach einem Jahr hast du 10.800 Euro. Der Gewinn ist 800 Euro. Die Rendite ist (800 / 10.000) × 100 = 8 Prozent.
Das funktioniert gut, solange du nur ein Jahr betrachtest. Aber was passiert, wenn dein Geld mehrere Jahre arbeitet? Oder wenn du am Anfang 5.000 Euro einzahlst, nach sechs Monaten nochmal 3.000 Euro, und kurz vor Ende noch 2.000 Euro? Dann wird es kompliziert – nicht weil die Mathematik schwer ist, sondern weil du entscheiden musst, wie du vergleichbar rechnen willst.
Die Zeit-gewichtete Rendite (TWR)
Hier kommt die Zeit-gewichtete Rendite (TWR) ins Spiel – die Messmethode der Profis. Sie berücksichtigt jeden Ein- und Ausstieg einzeln und bewertet nur die Rendite zwischen diesen Bewegungen. Die Idee: Deine Managemententscheidungen und die des Brokers sollen sich nicht vermischen.
Die TWR ist ideal, wenn du eine Geldanlage oder einen Fonds bewerten möchtest. Sie sagt: Unabhängig davon, wann und wie viel du eingezahlt hast, hier ist die reine Rendite-Leistung. Auf diese Weise können zwei Fonds mit völlig unterschiedlichen Einzahlungsmustern fair verglichen werden.
Die Berechnung ist aufwendiger – sie erfolgt in mehreren Schritten, und ohne Tabellenkalkulationstool wird es schnell fehleranfällig. Aber jede gute Finanzplattform rechnet das für dich aus.
Die geldgewichtete Rendite (MWR / IRR)
Die geldgewichtete Rendite (MWR) oder interne Rendite (IRR – Internal Rate of Return) ist die persönliche Perspektive. Sie antwortet auf die Frage: Was habe ich als Investor tatsächlich verdient?
Hier zählen deine Entscheidungen. Wenn du am Tiefpunkt 50.000 Euro eingezahlt hast, dann steigt der Wert danach massiv – das verbessert deine persönliche Rendite, obwohl die Fonds-Rendite (TWR) identisch ist. Umgekehrt: Wenn du vor einem Crash 100.000 Euro eingezahlt hast und dann alle Verluste abfangen musst, leidet deine MWR stärker.
Die MWR ist realistischer für deinen persönlichen Vermögensaufbau. Sie berücksichtigt, dass dein Timing zählt. Deshalb ist sie auch wichtiger als die TWR, wenn du dein eigenes Vermögen analysierst.
Die Formel ist mathematisch anspruchsvoll (Iteration einer Diskontierungsrechnung), aber auch das machen moderne Finanzrechner. Der Sinn: Du siehst, was du wirklich verdient hast – mit deinem echten Geldfluss, deinem echten Timing.
Rendite bereinigt um Gebühren und Steuern
Hier offenbart sich oft die Wahrheit: Deine Brutto-Rendite ist nicht deine echte Rendite.
Gebühren fressen oft 1–3 Prozent pro Jahr auf – Verwaltungsgebühren, Handelsgebühren, Provisionen. Eine 8-Prozent-Rendite wird schnell zur 5-Prozent-Rendite. Das klingt wie eine kleine Differenz, aber über 20 Jahre potenziert sich das zu massiven Vermögensunterschieden.
Steuern sind noch dramatischer. In Deutschland zahlst du auf Kapitalerträge 26,375 Prozent Abgeltungssteuer (plus Solidaritätszuschlag und eventuell Kirchensteuer). Eine 8-Prozent-Rendite wird zur 5,9-Prozent-Netto-Rendite. Manche Anleger rechnen hier falsch: Sie nehmen ihre Brutto-Rendite, freuen sich, und vergessen völlig, dass sie davon noch große Teile abtreten müssen.
Die effektive langfristige Anlagestrategien zeigen: Vermögensaufbau funktioniert nur, wenn du mit der Netto-Rendite rechnest. Alles andere ist Illusion.
Noch ein Punkt: Bei längerfristigen Halten können Steuerstundungseffekte helfen (nicht realisierte Gewinne), und in manchen Fällen ist das Timing von Gewinnen entscheidend. Aber das ist eine separate Rechnung.
Inflation: Der stille Killer
Du berechnest +5 Prozent Rendite und freust dich. Aber wenn die Inflation bei 3 Prozent liegt, ist deine echte Kaufkraft-Rendite nur +2 Prozent. Das klingt abstrakt, bis du es über 30 Jahre hinweg ausrechnest – dann verliert dein Vermögen dramatisch an Wert.
Die Real-Rendite ist die Brutto-Rendite minus Inflation. Sie sagt dir, ob dein Geld wirklich wächst oder nur nominell. Bei sehr niedrigen Renditen (Sparquoten, alte Lebensversicherungen) ist die Real-Rendite oft negativ. Du verlierst Kaufkraft, ohne es zu bemerken.
Wer langfristig Vermögen aufbauen will, muss Anlagen wählen, deren Rendite die Inflation schlägt – plus Gebühren, plus Steuern. Das sind oft Dividendenaktien 2024, diversifizierte ETFs oder alternatives Kapital. Die Safe-Anlagen (Tagesgeld, Anleihen unter 3 Prozent) sind mathematisch Vermögensvernichter.
Benchmark und risikoadjustierte Rendite
Eine letzte Ebene: Absolute Rendite zu messen ist nicht genug. Du musst sie auch vergleichen – mit einem Benchmark. Wenn dein Depot +4 Prozent gemacht hat, aber der DAX +8 Prozent, dann warst du unterdurchschnittlich, obwohl +4 Prozent objektiv gut klingt.
Der Benchmark hängt von deiner Strategie ab. Für deutsche Aktien: DAX oder MSCI Germany. Für globale Diversifikation: MSCI World. Für Anleihen: Bloomberg Barclays oder iBoxx. Für dein ganzes Portfolio: eine Mischung, die deiner Zielallokation entspricht.
Aber auch hier verstecken sich Fallstricke. Ein Fonds, der über dem Benchmark performt, aber dabei das Dreifache des Risikos trägt, ist kein Erfolg – das ist nur höherer Einsatz mit glücklichem Ausgang. Deshalb gibt es risikoadjustierte Kennzahlen wie die Sharpe Ratio oder die Information Ratio. Sie sagen: Wie viel Rendite pro Risiko-Einheit? Externe Quellen zu erweiterten Kennzahlen helfen dir, diese Tiefe zu verstehen.
Die häufigsten Rechenfehler
Viele Anleger machen systematische Fehler bei der Renditeberechnung:
- Arithmetische statt geometrische Mittelung: Wenn dein Depot im Jahr 1 um 20 Prozent steigt und im Jahr 2 um 10 Prozent fällt, ist die durchschnittliche Rendite nicht 15 Prozent, sondern etwa 4 Prozent (geometrisches Mittel). Die meisten addieren einfach und teilen durch zwei.
- Gebühren vergessen: Sie rechnen Brutto und glauben, das sei das echte Ergebnis.
- Steuern ignorieren: Gleicher Fehler wie bei Gebühren – noch dramatischer.
- Inflation übersehen: Sie sagen „5 Prozent Rendite“ und vergessen, dass Kaufkraft verloren ging.
- Ein- und Ausstiegszeitpunkt falsch gewichten: Sie zählen alle Gewinne gleich, obwohl ein Gewinn in Monat 1 mehr Kraft hatte als in Monat 11.
Diese Fehler sind keine mathematischen Missgeschicke. Sie sind psychologisch: Du willst die Zahl sehen, die gut aussieht. Die Wahrheit – Netto-Real-Rendite nach korrektem Timing – ist oft bescheidener. Aber sie ist der einzige Maßstab, der zählt.
Die Praxis: Tools und Realismus
Die gute Nachricht: Du brauchst nicht alles selbst zu rechnen. Hochwertige Renditerechner machen das für dich. Aber du solltest wissen, was dahinter steckt – sonst vertraust du den Ergebnissen nicht, oder noch schlimmer, du vertraust ihnen blind.
Die beste Strategie: Rechne deine persönliche Rendite (MWR) mindestens einmal pro Jahr. Vergleiche sie mit einem fairen Benchmark. Subtrahiere Gebühren und Steuern. Korrigiere um Inflation. Das ist unangenehm ehrlich – und genau das ist der Punkt. Wer seine echte Rendite kennt, trifft bessere Entscheidungen.
Die Rendite-Rechnung ist nicht Mathematik für Mathematiker. Sie ist ein Werkzeug für Menschen, die Vermögen aufbauen wollen. Und wer sein Werkzeug versteht, arbeitet besser.
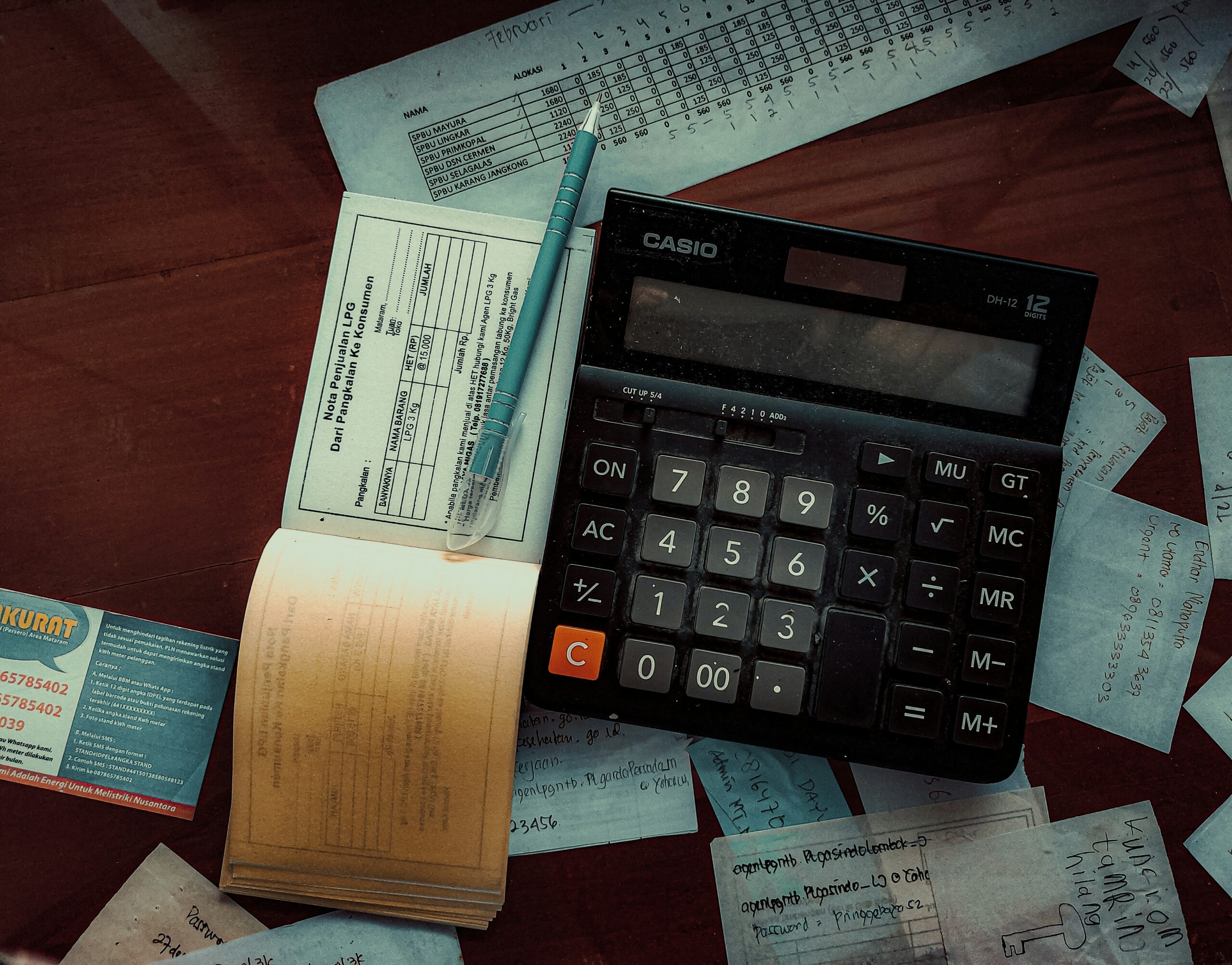
Schreiben Sie einen Kommentar